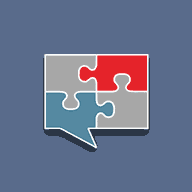OP
aristo
- Thread Starter
- #81
Auf welche absurden Modelle die Handlungsempfehlungen der "führenden Ökonomen" an die Politik beruhen, wird am Beispiel der ricardianischen Äquivalenz gezeigt.
Die ricardianische Äquivalenz
Häufig werden von Ökonomen und Politikern in der Öffentlichkeit prägnante Thesen vertreten, die auf Modellen basieren, die man lieber nicht genauer erklärt. Würde man dies nämlich tun, wäre sehr schnell klar, welche abstrusen Annahmen diesen theoretischen Modellen zugrunde liegen und kaum jemand nähme die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen noch ernst.
Ein klassisches Beispiel dafür ist die Behauptung, dass staatliche Defizite immer kontraproduktiv seien und daher ein Abbau dieser Defizite – selbst inmitten einer Rezession – nicht nur keinen Schaden anrichte, sondern ganz im Gegenteil gut für die Wirtschaft sei. Diese Behauptung stützt sich auf das Theorem der „ricardianischen Äquivalenz“, das bereits im Jahr 1821 von David Ricardo entwickelt wurde und auf das im Folgenden näher eingegangen wird.
So kritisiert beispielsweise Fabre (2012) die frühere Entscheidung der französischen Regierung, ihr Staatsdefizit nur langsam und moderat zu verringern, heftig, da dies das Wachstumspotenzial der Wirtschaft Frankreichs belaste. Unter expliziter Berufung auf die „ricardianischen Effekte“ behauptet er: „Eine rigorose Ausgabenkürzung hätte, ceteris paribus, steigende Wachstumsraten zur Folge. Wie Kanada, Schweden oder Dänemark hat auch Deutschland gezeigt, dass eine Politik der Reduktion der Staatsverschuldung günstige Voraussetzungen dafür schafft, dass es zu einer wettbewerbsfähigen und kreativen Vermehrung von Arbeitsplätzen kommt“ (Fabre 2012, S. 12).
Was aber ist nun das Theorem der „ricardianischen Äquivalenz“? Die Idee stammt – wie bereits erwähnt – von David Ricardo und wurde 1974 vom Harvard-Ökonomen Robert Barro wiederbelebt und mathematisch erweitert. Danach ist es für einen Staat gleichwertig (daher der Begriff der „ricardianischen Äquivalenz“), ob er seine Ausgaben durch Steuern finanziert oder durch Anleihen. Denn die Defizite von heute seien die Steuern von morgen. Ein Budgetdefizit ist nach Barro nichts anderes als eine implizite Verpflichtung des Staates, in der Zukunft die Steuern zu erhöhen, um die Schulden (Kapital und Zinsen) zurückzahlen zu können. Wie reagieren also die Konsumenten und Unternehmen darauf? In Erwartung einer größeren zukünftigen Steuerbelastung erhöhten sie ihre gegenwärtige Ersparnis, um sicherzustellen, dass sie ihren zukünftigen Steuerverpflichtungen nachkommen könnten. Oder etwas genauer: Da sie wüssten, dass der gegenwärtige, schuldenfinanzierte Staatshaushalt zwangsläufig zu Steuererhöhungen in der Zukunft führe, aus denen der Staat dann die zusätzlichen Schulden zurückzahlen müsse, reagierten die privaten Akteure auf die erhöhten Staatsausgaben sofort mit zusätzlichem Sparen, um auf die zu erwartenden höheren Steuern vorbereitet zu sein. Jede Erhöhung der Staatsausgaben führe damit unmittelbar zu einem Rückgang der Ausgaben für Waren und Dienstleistungen im Privatsektor.
Übertragen auf den Euroraum bedeutet dies: Unternähme die Regierung eines Eurolandes den Versuch, mit einem kreditfinanzierten Ausgabenprogramm zusätzliche Nachfrage und damit zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, wäre dieser Versuch zum Scheitern verurteilt. Denn der ricardianische Äquivalenzeffekt würde bei den Steuerzahlern sofort einen Anstieg des Sparens aus ihrem laufenden Einkommen auslösen, mit dem Ergebnis, dass die private Nachfrage in exakt gleichem Umfang sänke, wie die staatliche Nachfrage als Folge des Stimulierungsprogramms zunähme. Gestiegene staatliche Ausgaben würden mithin durch verringerte private Ausgaben ausgeglichen: es gäbe gewissermaßen ein Patt.
Staatsausgaben haben folglich nach Barro keinen realen Effekt auf Produktion und Beschäftigung, ganz egal, ob sie durch Steuern oder durch Verschuldung finanziert werden. Wenn dagegen – so die Folgerung der Ricardo-Anhänger – die Regierungen Austeritätsmaßnahmen ankündigten, nähmen die Privatausgaben sofort zu und das Wirtschaftswachstum ziehe wieder an, da sich die allgemeine Erwartung durchsetze, dass die zukünftigen Steuerbelastungen niedriger sein würden.
Man könnte jetzt annehmen, dass die „ricardianische Äquivalenz“ eine von vielen theoretischen Spielereien ist, deren praktische Relevanz jedoch gegen Null geht. Dem ist leider nicht so: Barros ricardianische Äquivalenztheorie ist nicht nur die offizielle Position der Europäischen Kommission in Brüssel, sondern wird auch von Reinhart/Rogoff (2010, S. 6) verwendet, um zu erklären, warum hohe Schuldenstände mit niedrigen Wachstumsraten einhergehen. Zur Erinnerung: Die Studie „Growth in a Time of Debt“ von Reinhart/Rogoff hatte – so Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman (Krugman 2013) – vielleicht einen größeren unmittelbaren Einfluss auf die öffentliche Debatte als jede andere wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung zuvor. Reinhart/Rogoff hatten festgestellt, dass eine Staatsschuldenquote, die den Schwellenwert von 90 Prozent überschreite, das Wachstum signifikant verringere. Obgleich die beiden Autoren schon frühzeitig hinsichtlich ihrer Methodik und ihrer Schlussfolgerungen kritisiert wurden (z. B. von Wray/Nersisyarn 2011), diente ihre Studie lange als Legitimation einer harschen Austeritätspolitik, bis sich herausstellte, dass die behauptete 90-Prozent-Schwelle schlicht das Ergebnis von Rechenfehlern war.
Aber nicht nur Ökonomen berufen sich auf die „ricardianische Äquivalenz“, auch viele Politiker haben sich die Argumentation zu eigen gemacht, manche von ihnen vielleicht, ohne zu wissen, auf welchen Prämissen sie basiert. So erklärte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem letzten EU-Gipfel in Brüssel Ende Juni dieses Jahres: „Wachstum und Haushaltskonsolidierung sind keine Gegensätze, im Gegenteil, sie bedingen einander.“ Politiker anderer Länder teilen diese Auffassung, beispielsweise in Großbritannien, wo Premierminister David Cameron und Schatzkanzler George Osborne mehrfach verkündeten, dass die britische Wirtschaft eine „expansive Fiskalkontraktion“ (expansionary fiscal contraction) erreichen könnte: Wenn man die öffentlichen Ausgaben kürze, komme es zu mehr privaten Ausgaben.[2] Ähnlich äußerte sich Christine Lagarde, damalige Ministerin für Wirtschaft und Finanzen in Frankreich und jetzt geschäftsführende Direktorin des IWF: „Wenn wir nicht das öffentliche Defizit reduzieren, wird nicht das Wachstum begünstigt. Warum? Weil die Menschen sich Sorgen machen über das öffentliche Defizit. Wenn sie sich darüber Sorgen machen, fangen sie an zu sparen. Wenn sie zuviel sparen, konsumieren sie nicht. Wenn sie nicht konsumieren, steigt die Arbeitslosigkeit und die Produktion sinkt. Deshalb müssen wir diesen Kreislauf vom Defizit her attackieren“ (Lagarde 2010; Übersetzung G. G.).
Im Folgenden soll Barros Version der ricardianischen Äquivalenz einer theoretischen Prüfung unterzogen werden. Welche Annahmen müssen gelten, damit sich Barros Schlussfolgerungen logisch widerspruchsfrei ableiten lassen? Bei der Beantwortung dieser Frage bleibt unberücksichtigt, ob die Argumentation Barros überhaupt eine realistische Darstellung der Funktionsweise eines modernen Geldsystems ist (dies ist nicht der Fall, vgl. z. B. Mitchell 2009). Das heißt, es wird allein die Plausibilität der zugrundeliegenden Modellannahmen untersucht. Sollte irgendeine dieser äußerst restriktiven Annahmen nicht zutreffen, lassen sich auch die darauf basierenden Ergebnisse nicht aufrechterhalten.
Insgesamt müssen vier Annahmen erfüllt sein (dazu auch Mitchell 2011):
Erstens wird unterstellt, dass alle Bürger aus der gegenwärtigen Entwicklung der Staatsausgaben präzise abschätzen können, wie hoch ihre Steuerbelastung in der Zukunft, also beispielsweise in zehn oder zwanzig Jahren, sein wird. Und nicht nur das: Jedes Individuum ist imstande, aus seiner zukünftigen Steuerbelastung abzuleiten, wie viel es in der Gegenwart konsumiert oder spart. Alle Menschen sind in der Lage, ihre gesamten Einkommen und zu zahlenden Steuern über ihr gesamtes Leben hinweg einzuschätzen, wenn sie in jeder Zeitperiode ihre Konsumentscheidungen treffen. Es dürfte unmittelbar einleuchten, dass diese Vorstellung abwegig ist: Natürlich kennt niemand sein Gesamteinkommen in der Zukunft.
Zweitens müssen die Kapitalmärkte „perfekt“ sein. Jeder Haushalt kann jederzeit soviel Kredit aufnehmen oder sparen, wie er möchte – und zwar zu einem festen Zinssatz, der zu jedem Zeitpunkt für alle gleich ist. Anders ausgedrückt: Es besteht für alle Individuen ein vollkommen gleicher Zugang zu Finanzmitteln. Zweifellos kann diese Annahme nicht für alle Individuen und Zeiträume gelten. Haushalte haben Liquiditätsbeschränkungen und können nicht jederzeit und in jedem Umfang Geld leihen und anlegen, wie es ihnen gefällt.
Drittens muss die zukünftige Entwicklung der Staatsausgaben feststehen und den privaten Haushalten bzw. den Individuen, die annahmegemäß über perfekte Voraussicht verfügen (zu einer umfassenden Kritik daran vgl. Minsky 1995, S. 10ff), bekannt sein. Auch diese Prämisse ist komplett realitätsfern, da natürlich niemand perfekte Voraussicht hat und genau weiß, wieviel welche Regierung in zehn oder fünfzehn Jahren ausgeben wird.
Viertens besteht eine zeitlich unbegrenzte Sorge um die zukünftigen Generationen. Diese Annahme ist deshalb notwendig, weil sich aus der internen Logik des Modells keine Vorhersage ableiten lässt, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft die Steuererhöhungen zur Schuldenrückzahlung anfallen werden. Natürlich kann der Staat (der – anders als ein Unternehmen oder ein privater Haushalt – praktisch ewig bestehen bleibt) seine Schulden, statt sie zurückzuzahlen, auch immer nur wieder refinanzieren, d.h. alte Kredite durch neue ablösen. Die Erhöhung der Steuern, die angeblich erforderlich ist, um die Schulden des Staates zurückzuzahlen, könnte also in ferner Zukunft erfolgen, möglicherweise erst in hundert Jahren oder noch viel später. Ob aber tatsächlich eine relevante Zahl von Menschen heute ihre privaten Ausgaben verringert, um (vererbbare) Sicherheitsersparnisse für den Fall zu bilden, dass irgendwann in vielleicht einhundert oder zweihundert Jahren die Steuern angehoben werden, darf wohl bezweifelt werden.
Das Fazit ist eindeutig: Die Theorie der ricardianischen Äquivalenz ist aufgrund ihrer abstrusen Annahmen und Unplausibilitäten theoretisch nicht haltbar. Dies gilt selbst dann, wenn man ihre weiteren Modellannahmen (beispielsweise die unzutreffende These, dass der Staat in irgendeiner zukünftigen Periode seine Steuern erhöhen muss, um seine schuldenfinanzierten Ausgaben der Vergangenheit zurückzuzahlen) vorbehaltlos akzeptiert.
Interessanterweise hat die Theorie gleich ihren ersten großen „Praxistest“ nicht bestanden. Nachdem Barro seine Version der ricardianischen Äquivalenz präsentiert hatte, wurde in vielen empirischen Untersuchungen ihre „Vorhersagefähigkeit“ geprüft. Eine günstige Gelegenheit ergab sich, als der US-Kongress im August 1981 umfangreiche Steuersenkungen beschloss, weil sich die USA in einer Rezession befanden. Die Steuerreduzierungen sollten zwischen 1982 und 1984 zum Einsatz kommen, um die aggregierte Nachfrage zu stimulieren. Die Anhänger Barros prognostizierten, dass – gemäß der Theorie der ricardianischen Äquivalenz – die Menschen nun befürchten würden, dass diese Steuersenkungen über eine entsprechende Ausweitung der staatlichen Finanzierungsdefizite finanziert werden. Folglich werde der Konsum nicht zunehmen und die Menschen würden mehr sparen, um für die wachsende zukünftige Steuerbelastung aufgrund des Anstiegs der öffentlichen Verschuldung vorzusorgen. Die Realität sah völlig anders aus: Die Sparquote der privaten Haushalte stieg keineswegs, sondern sank ganz im Gegenteil von 7,5 Prozent im Jahr 1981 auf durchschnittlich 5,7 Prozent in den Jahren 1982 bis 1984.
In der Folgezeit gab es eine Vielzahl empirischer Studien, auch von konservativen Ökonomen, die keinerlei Belege für die Gültigkeit der Ricardo/Barro-These fanden (z. B. Feldstein 1986; Feldstein/Elmendorf 1987; Evans 1993; Stanley 1998; Niple 2006; Waqas/Awan 2011 und 2012). Das ist wenig überraschend: Konsumenten, die bei Kürzungen der öffentlichen Ausgaben in Hochstimmung geraten, weil sie nun keine späteren Steuererhöhungen wegen höherer Defizite mehr befürchten müssen; die deshalb aufhören, für zukünftig zu erwartende Steueranhebungen zu sparen und stattdessen anfangen, mehr Geld auszugeben, selbst wenn die Arbeitslosigkeit sprunghaft ansteigt und die Löhne gekürzt werden; Unternehmen, die hohe Staatsdefizite hassen und deshalb bei staatlichen Haushaltskürzungen freudig in neue Produktionsanlagen investieren, obgleich die vorhandenen Kapazitäten mehr als ausreichend sind, um die aktuelle Nachfrage zu befriedigen, und obwohl der Absatz einbricht – solche Wirtschaftsakteure dürften in der realen Welt wohl sehr selten vorkommen.
Dass eine Theorie, die ein derartiges Verhalten unterstellt und die sich (natürlich) empirisch nicht bestätigen lässt, dennoch zur Handlungsanleitung für die Politik in Europa werden konnte, ist nicht nur in höchstem Maße verwunderlich, sondern schlicht unbegreiflich.
(Auszug aus: Die kläglichen Fundamente der Austeritätspolitik von Günther Grundert)
Es ist weniger verwunderlich wenn man weiß, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Wer Einsteins Unsinn nicht glaubt, hat in der Physik keine Chance. Ähnlich ist es in der "Wirtschaftswissenschaft". Hier werden Irrlehren weitergegeben und die dann "führenden Ökonomen" bestätigen sich gegenseitig.
Hier wird geistige Inzucht auf hohem Niveau betrieben. Da die Deutschen schon immer expertenhörig waren, fressen sie diesen brav aus der Hand, egal was ihnen vorgehalten wird.
Die ricardianische Äquivalenz
Häufig werden von Ökonomen und Politikern in der Öffentlichkeit prägnante Thesen vertreten, die auf Modellen basieren, die man lieber nicht genauer erklärt. Würde man dies nämlich tun, wäre sehr schnell klar, welche abstrusen Annahmen diesen theoretischen Modellen zugrunde liegen und kaum jemand nähme die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen noch ernst.
Ein klassisches Beispiel dafür ist die Behauptung, dass staatliche Defizite immer kontraproduktiv seien und daher ein Abbau dieser Defizite – selbst inmitten einer Rezession – nicht nur keinen Schaden anrichte, sondern ganz im Gegenteil gut für die Wirtschaft sei. Diese Behauptung stützt sich auf das Theorem der „ricardianischen Äquivalenz“, das bereits im Jahr 1821 von David Ricardo entwickelt wurde und auf das im Folgenden näher eingegangen wird.
So kritisiert beispielsweise Fabre (2012) die frühere Entscheidung der französischen Regierung, ihr Staatsdefizit nur langsam und moderat zu verringern, heftig, da dies das Wachstumspotenzial der Wirtschaft Frankreichs belaste. Unter expliziter Berufung auf die „ricardianischen Effekte“ behauptet er: „Eine rigorose Ausgabenkürzung hätte, ceteris paribus, steigende Wachstumsraten zur Folge. Wie Kanada, Schweden oder Dänemark hat auch Deutschland gezeigt, dass eine Politik der Reduktion der Staatsverschuldung günstige Voraussetzungen dafür schafft, dass es zu einer wettbewerbsfähigen und kreativen Vermehrung von Arbeitsplätzen kommt“ (Fabre 2012, S. 12).
Was aber ist nun das Theorem der „ricardianischen Äquivalenz“? Die Idee stammt – wie bereits erwähnt – von David Ricardo und wurde 1974 vom Harvard-Ökonomen Robert Barro wiederbelebt und mathematisch erweitert. Danach ist es für einen Staat gleichwertig (daher der Begriff der „ricardianischen Äquivalenz“), ob er seine Ausgaben durch Steuern finanziert oder durch Anleihen. Denn die Defizite von heute seien die Steuern von morgen. Ein Budgetdefizit ist nach Barro nichts anderes als eine implizite Verpflichtung des Staates, in der Zukunft die Steuern zu erhöhen, um die Schulden (Kapital und Zinsen) zurückzahlen zu können. Wie reagieren also die Konsumenten und Unternehmen darauf? In Erwartung einer größeren zukünftigen Steuerbelastung erhöhten sie ihre gegenwärtige Ersparnis, um sicherzustellen, dass sie ihren zukünftigen Steuerverpflichtungen nachkommen könnten. Oder etwas genauer: Da sie wüssten, dass der gegenwärtige, schuldenfinanzierte Staatshaushalt zwangsläufig zu Steuererhöhungen in der Zukunft führe, aus denen der Staat dann die zusätzlichen Schulden zurückzahlen müsse, reagierten die privaten Akteure auf die erhöhten Staatsausgaben sofort mit zusätzlichem Sparen, um auf die zu erwartenden höheren Steuern vorbereitet zu sein. Jede Erhöhung der Staatsausgaben führe damit unmittelbar zu einem Rückgang der Ausgaben für Waren und Dienstleistungen im Privatsektor.
Übertragen auf den Euroraum bedeutet dies: Unternähme die Regierung eines Eurolandes den Versuch, mit einem kreditfinanzierten Ausgabenprogramm zusätzliche Nachfrage und damit zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, wäre dieser Versuch zum Scheitern verurteilt. Denn der ricardianische Äquivalenzeffekt würde bei den Steuerzahlern sofort einen Anstieg des Sparens aus ihrem laufenden Einkommen auslösen, mit dem Ergebnis, dass die private Nachfrage in exakt gleichem Umfang sänke, wie die staatliche Nachfrage als Folge des Stimulierungsprogramms zunähme. Gestiegene staatliche Ausgaben würden mithin durch verringerte private Ausgaben ausgeglichen: es gäbe gewissermaßen ein Patt.
Staatsausgaben haben folglich nach Barro keinen realen Effekt auf Produktion und Beschäftigung, ganz egal, ob sie durch Steuern oder durch Verschuldung finanziert werden. Wenn dagegen – so die Folgerung der Ricardo-Anhänger – die Regierungen Austeritätsmaßnahmen ankündigten, nähmen die Privatausgaben sofort zu und das Wirtschaftswachstum ziehe wieder an, da sich die allgemeine Erwartung durchsetze, dass die zukünftigen Steuerbelastungen niedriger sein würden.
Man könnte jetzt annehmen, dass die „ricardianische Äquivalenz“ eine von vielen theoretischen Spielereien ist, deren praktische Relevanz jedoch gegen Null geht. Dem ist leider nicht so: Barros ricardianische Äquivalenztheorie ist nicht nur die offizielle Position der Europäischen Kommission in Brüssel, sondern wird auch von Reinhart/Rogoff (2010, S. 6) verwendet, um zu erklären, warum hohe Schuldenstände mit niedrigen Wachstumsraten einhergehen. Zur Erinnerung: Die Studie „Growth in a Time of Debt“ von Reinhart/Rogoff hatte – so Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman (Krugman 2013) – vielleicht einen größeren unmittelbaren Einfluss auf die öffentliche Debatte als jede andere wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung zuvor. Reinhart/Rogoff hatten festgestellt, dass eine Staatsschuldenquote, die den Schwellenwert von 90 Prozent überschreite, das Wachstum signifikant verringere. Obgleich die beiden Autoren schon frühzeitig hinsichtlich ihrer Methodik und ihrer Schlussfolgerungen kritisiert wurden (z. B. von Wray/Nersisyarn 2011), diente ihre Studie lange als Legitimation einer harschen Austeritätspolitik, bis sich herausstellte, dass die behauptete 90-Prozent-Schwelle schlicht das Ergebnis von Rechenfehlern war.
Aber nicht nur Ökonomen berufen sich auf die „ricardianische Äquivalenz“, auch viele Politiker haben sich die Argumentation zu eigen gemacht, manche von ihnen vielleicht, ohne zu wissen, auf welchen Prämissen sie basiert. So erklärte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem letzten EU-Gipfel in Brüssel Ende Juni dieses Jahres: „Wachstum und Haushaltskonsolidierung sind keine Gegensätze, im Gegenteil, sie bedingen einander.“ Politiker anderer Länder teilen diese Auffassung, beispielsweise in Großbritannien, wo Premierminister David Cameron und Schatzkanzler George Osborne mehrfach verkündeten, dass die britische Wirtschaft eine „expansive Fiskalkontraktion“ (expansionary fiscal contraction) erreichen könnte: Wenn man die öffentlichen Ausgaben kürze, komme es zu mehr privaten Ausgaben.[2] Ähnlich äußerte sich Christine Lagarde, damalige Ministerin für Wirtschaft und Finanzen in Frankreich und jetzt geschäftsführende Direktorin des IWF: „Wenn wir nicht das öffentliche Defizit reduzieren, wird nicht das Wachstum begünstigt. Warum? Weil die Menschen sich Sorgen machen über das öffentliche Defizit. Wenn sie sich darüber Sorgen machen, fangen sie an zu sparen. Wenn sie zuviel sparen, konsumieren sie nicht. Wenn sie nicht konsumieren, steigt die Arbeitslosigkeit und die Produktion sinkt. Deshalb müssen wir diesen Kreislauf vom Defizit her attackieren“ (Lagarde 2010; Übersetzung G. G.).
Im Folgenden soll Barros Version der ricardianischen Äquivalenz einer theoretischen Prüfung unterzogen werden. Welche Annahmen müssen gelten, damit sich Barros Schlussfolgerungen logisch widerspruchsfrei ableiten lassen? Bei der Beantwortung dieser Frage bleibt unberücksichtigt, ob die Argumentation Barros überhaupt eine realistische Darstellung der Funktionsweise eines modernen Geldsystems ist (dies ist nicht der Fall, vgl. z. B. Mitchell 2009). Das heißt, es wird allein die Plausibilität der zugrundeliegenden Modellannahmen untersucht. Sollte irgendeine dieser äußerst restriktiven Annahmen nicht zutreffen, lassen sich auch die darauf basierenden Ergebnisse nicht aufrechterhalten.
Insgesamt müssen vier Annahmen erfüllt sein (dazu auch Mitchell 2011):
Erstens wird unterstellt, dass alle Bürger aus der gegenwärtigen Entwicklung der Staatsausgaben präzise abschätzen können, wie hoch ihre Steuerbelastung in der Zukunft, also beispielsweise in zehn oder zwanzig Jahren, sein wird. Und nicht nur das: Jedes Individuum ist imstande, aus seiner zukünftigen Steuerbelastung abzuleiten, wie viel es in der Gegenwart konsumiert oder spart. Alle Menschen sind in der Lage, ihre gesamten Einkommen und zu zahlenden Steuern über ihr gesamtes Leben hinweg einzuschätzen, wenn sie in jeder Zeitperiode ihre Konsumentscheidungen treffen. Es dürfte unmittelbar einleuchten, dass diese Vorstellung abwegig ist: Natürlich kennt niemand sein Gesamteinkommen in der Zukunft.
Zweitens müssen die Kapitalmärkte „perfekt“ sein. Jeder Haushalt kann jederzeit soviel Kredit aufnehmen oder sparen, wie er möchte – und zwar zu einem festen Zinssatz, der zu jedem Zeitpunkt für alle gleich ist. Anders ausgedrückt: Es besteht für alle Individuen ein vollkommen gleicher Zugang zu Finanzmitteln. Zweifellos kann diese Annahme nicht für alle Individuen und Zeiträume gelten. Haushalte haben Liquiditätsbeschränkungen und können nicht jederzeit und in jedem Umfang Geld leihen und anlegen, wie es ihnen gefällt.
Drittens muss die zukünftige Entwicklung der Staatsausgaben feststehen und den privaten Haushalten bzw. den Individuen, die annahmegemäß über perfekte Voraussicht verfügen (zu einer umfassenden Kritik daran vgl. Minsky 1995, S. 10ff), bekannt sein. Auch diese Prämisse ist komplett realitätsfern, da natürlich niemand perfekte Voraussicht hat und genau weiß, wieviel welche Regierung in zehn oder fünfzehn Jahren ausgeben wird.
Viertens besteht eine zeitlich unbegrenzte Sorge um die zukünftigen Generationen. Diese Annahme ist deshalb notwendig, weil sich aus der internen Logik des Modells keine Vorhersage ableiten lässt, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft die Steuererhöhungen zur Schuldenrückzahlung anfallen werden. Natürlich kann der Staat (der – anders als ein Unternehmen oder ein privater Haushalt – praktisch ewig bestehen bleibt) seine Schulden, statt sie zurückzuzahlen, auch immer nur wieder refinanzieren, d.h. alte Kredite durch neue ablösen. Die Erhöhung der Steuern, die angeblich erforderlich ist, um die Schulden des Staates zurückzuzahlen, könnte also in ferner Zukunft erfolgen, möglicherweise erst in hundert Jahren oder noch viel später. Ob aber tatsächlich eine relevante Zahl von Menschen heute ihre privaten Ausgaben verringert, um (vererbbare) Sicherheitsersparnisse für den Fall zu bilden, dass irgendwann in vielleicht einhundert oder zweihundert Jahren die Steuern angehoben werden, darf wohl bezweifelt werden.
Das Fazit ist eindeutig: Die Theorie der ricardianischen Äquivalenz ist aufgrund ihrer abstrusen Annahmen und Unplausibilitäten theoretisch nicht haltbar. Dies gilt selbst dann, wenn man ihre weiteren Modellannahmen (beispielsweise die unzutreffende These, dass der Staat in irgendeiner zukünftigen Periode seine Steuern erhöhen muss, um seine schuldenfinanzierten Ausgaben der Vergangenheit zurückzuzahlen) vorbehaltlos akzeptiert.
Interessanterweise hat die Theorie gleich ihren ersten großen „Praxistest“ nicht bestanden. Nachdem Barro seine Version der ricardianischen Äquivalenz präsentiert hatte, wurde in vielen empirischen Untersuchungen ihre „Vorhersagefähigkeit“ geprüft. Eine günstige Gelegenheit ergab sich, als der US-Kongress im August 1981 umfangreiche Steuersenkungen beschloss, weil sich die USA in einer Rezession befanden. Die Steuerreduzierungen sollten zwischen 1982 und 1984 zum Einsatz kommen, um die aggregierte Nachfrage zu stimulieren. Die Anhänger Barros prognostizierten, dass – gemäß der Theorie der ricardianischen Äquivalenz – die Menschen nun befürchten würden, dass diese Steuersenkungen über eine entsprechende Ausweitung der staatlichen Finanzierungsdefizite finanziert werden. Folglich werde der Konsum nicht zunehmen und die Menschen würden mehr sparen, um für die wachsende zukünftige Steuerbelastung aufgrund des Anstiegs der öffentlichen Verschuldung vorzusorgen. Die Realität sah völlig anders aus: Die Sparquote der privaten Haushalte stieg keineswegs, sondern sank ganz im Gegenteil von 7,5 Prozent im Jahr 1981 auf durchschnittlich 5,7 Prozent in den Jahren 1982 bis 1984.
In der Folgezeit gab es eine Vielzahl empirischer Studien, auch von konservativen Ökonomen, die keinerlei Belege für die Gültigkeit der Ricardo/Barro-These fanden (z. B. Feldstein 1986; Feldstein/Elmendorf 1987; Evans 1993; Stanley 1998; Niple 2006; Waqas/Awan 2011 und 2012). Das ist wenig überraschend: Konsumenten, die bei Kürzungen der öffentlichen Ausgaben in Hochstimmung geraten, weil sie nun keine späteren Steuererhöhungen wegen höherer Defizite mehr befürchten müssen; die deshalb aufhören, für zukünftig zu erwartende Steueranhebungen zu sparen und stattdessen anfangen, mehr Geld auszugeben, selbst wenn die Arbeitslosigkeit sprunghaft ansteigt und die Löhne gekürzt werden; Unternehmen, die hohe Staatsdefizite hassen und deshalb bei staatlichen Haushaltskürzungen freudig in neue Produktionsanlagen investieren, obgleich die vorhandenen Kapazitäten mehr als ausreichend sind, um die aktuelle Nachfrage zu befriedigen, und obwohl der Absatz einbricht – solche Wirtschaftsakteure dürften in der realen Welt wohl sehr selten vorkommen.
Dass eine Theorie, die ein derartiges Verhalten unterstellt und die sich (natürlich) empirisch nicht bestätigen lässt, dennoch zur Handlungsanleitung für die Politik in Europa werden konnte, ist nicht nur in höchstem Maße verwunderlich, sondern schlicht unbegreiflich.
(Auszug aus: Die kläglichen Fundamente der Austeritätspolitik von Günther Grundert)
Es ist weniger verwunderlich wenn man weiß, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Wer Einsteins Unsinn nicht glaubt, hat in der Physik keine Chance. Ähnlich ist es in der "Wirtschaftswissenschaft". Hier werden Irrlehren weitergegeben und die dann "führenden Ökonomen" bestätigen sich gegenseitig.
Hier wird geistige Inzucht auf hohem Niveau betrieben. Da die Deutschen schon immer expertenhörig waren, fressen sie diesen brav aus der Hand, egal was ihnen vorgehalten wird.